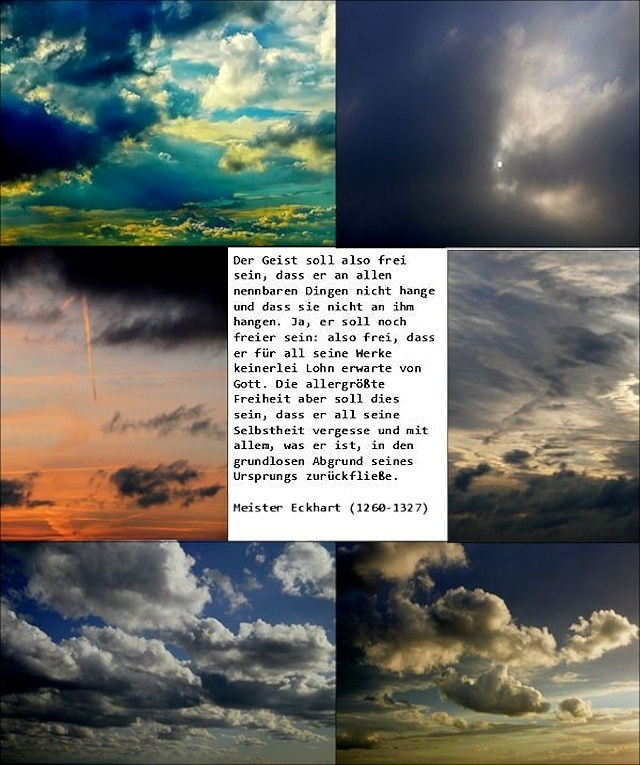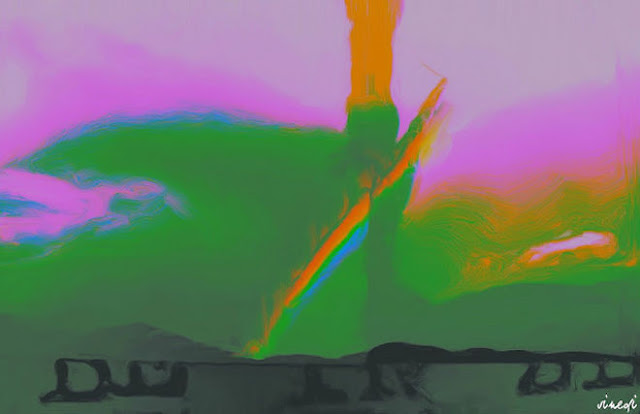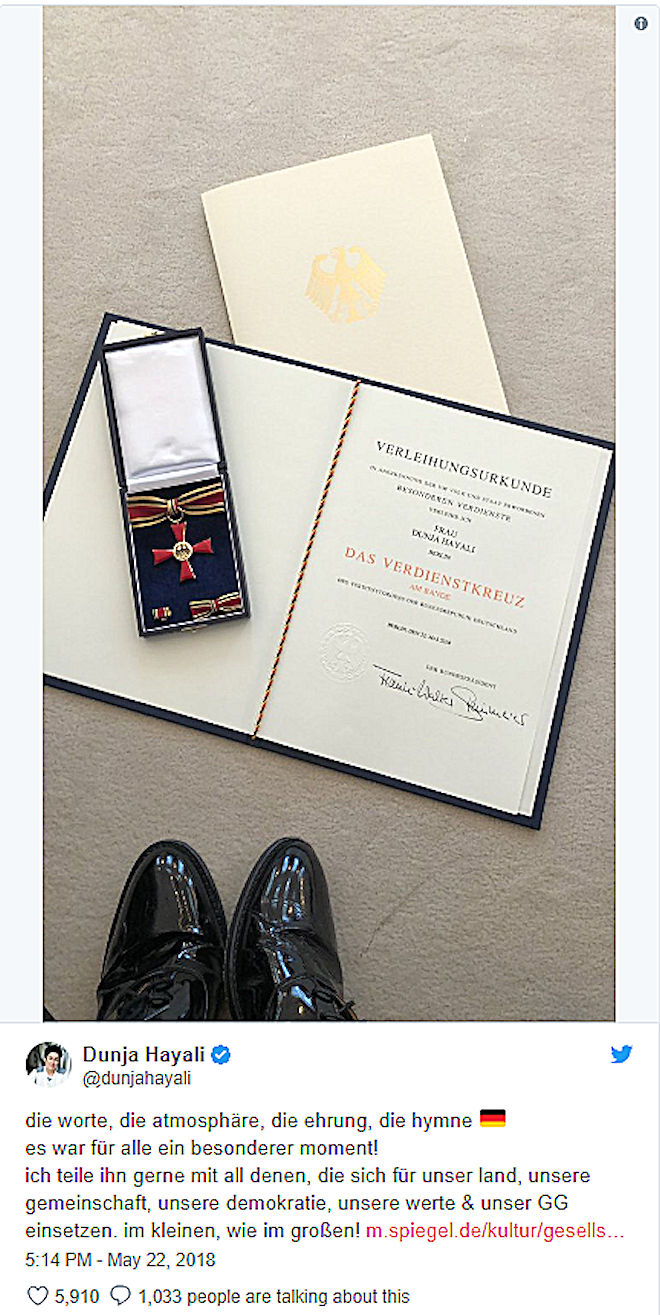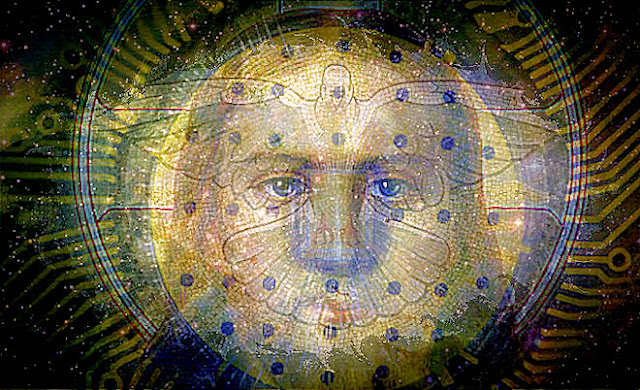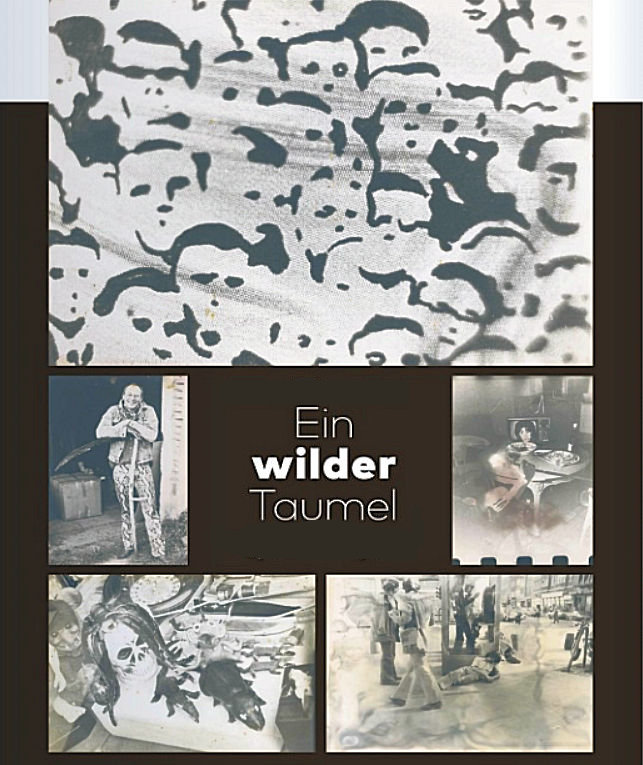![]() |
| Monika Grütters - Foto: DIE ZEIT |
Interview mit Kulturstaatsministerin Grütters"Auch wir waren locker und widerspenstig"Wie denkt die Kulturstaatsministerin über die Wiederkehr konservativer Normen? Ein Besuch bei Monika Grütters. Von Sebastian Hammelehle, Ulrike KnöfelGrütters, 1962 in Münster geboren und seit 2013 Kulturstaatsministerin, ist neben Angela Merkel und Ursula von der Leyen die einzige Politikerin, die aus der alten in die neue Regierung gewechselt ist. Sie empfängt in ihrem Büro im Kanzleramt, mit Blick auf den Reichstag. Es geht um Fragen der Identität, die Renaissance konservativer Werte und ihren persönlichen Ehrgeiz auf andere Ämter.
SPIEGEL: Frau Grütters, Sie sind 1978 in die Junge Union eingetreten, als 16-Jährige. Warum?
Grütters: Weil wir in Münster gute CDU-Leute hatten. Und weil ich schon damals ein politischer Mensch war.
SPIEGEL: Der Zeitgeist der Siebzigerjahre war völlig anders: Da waren die Langhaarigen, die Punks – und dazwischen Sie, das Mädchen von der Jungen Union?
Grütters: Auch wir waren locker und etwas widerspenstig. Auch ich wollte unbedingt mit einem Palästinensertuch herumlaufen oder mit diesen lila gefärbten Windeln um den Hals. Oder Patschuliparfum und Vanilletee, Berberjacke, Parka, Kreppsohlenschuhe, Clogs – all das musste sein. Ich habe mich mit meiner Jeans in die Badewanne gelegt, damit sie wirklich hauteng ist, oder nachts heimlich Flicken daraufgenäht. Meine Mutter meinte: Damit kannst du nicht als Messdienerin vor den Altar treten ...
SPIEGEL: Haben Sie denn Franz Josef Strauß unterstützt? 1980, als Sie 18 waren, trat er als Kanzlerkandidat der Union an.
Grütters: Strauß fand ich echt schwierig. Aber als er auf einem Poster als Fleischermeister, als Schlächter verunglimpft wurde, haben sogar wir Jüngeren uns mit ihm solidarisiert.
SPIEGEL: Das war ein Plakat des Politgrafikers Klaus Staeck, eines SPD-Mitglieds. Strauß war für viele ein Gottseibeiuns, für die Linke damals in etwa das, was heute die AfD ist.
Grütters: Mutige These.
SPIEGEL: Für seine politischen Gegner war er die Hassfigur schlechthin.
Grütters: Das stimmt. Nur war man damals generell nicht gerade zimperlich im Umgang miteinander.
SPIEGEL: Sie haben Geisteswissenschaften studiert, da wehte der Geist links. Fühlten Sie sich gemobbt von Ihren linken Kommilitonen?
Grütters: Die schärfste Form solchen Mobbings habe ich in Münster erlebt, wo ich zuerst studiert habe. Als sich der Asta vorstellte, saß ich im Publikum für den Ring Christlich-Demokratischer Studenten, bis der Hausmeister kam und mich – auf dem Stuhl sitzend – heraustrug. Ich würde da nicht hingehören, meinte er. Später bin ich nach Bonn gewechselt. Das war die Zeit der Demos im Hofgarten, gegen Pershing II und die Nachrüstung.
SPIEGEL: Haben Sie mitdemonstriert?
Grütters: Wir haben viel diskutiert, über Aufrüstung, über das Gleichgewicht der Kräfte oder: Wenn der Klügere immer nachgibt, regieren nur noch die Dummen. Ein naiver Pazifismus war unsere Sache nicht, Hochrüstung aber auch nicht.
SPIEGEL: Haben Sie damals nie an der CDU gezweifelt?
Grütters: Doch, als Kurt Biedenkopf Mitte der Achtziger von Helmut Kohl als Spitzenkandidat in NRW abserviert wurde. Und später, 1989, als Heiner Geißler als CDU-Generalsekretär das Feld räumen musste, auch er irgendwie ein Opfer Kohls. Ich habe per Brief meinen Parteiaustritt mitgeteilt und ihn wohl auch abgeschickt, aber ich glaube, die haben das bei der CDU nie registriert.
SPIEGEL: Warum hat Sie die Sache mit Geißler so aufgebracht?
Grütters: Ich bin bis heute eine große Bewunderin Heiner Geißlers, der eine intellektuelle Schärfe hatte, der austeilen konnte und einstecken. Vor allem hat er die CDU sozialpolitisch geformt und bis heute nachhaltig geprägt.
SPIEGEL: Hat er die Sozialdemokratisierung der CDU eingeleitet, die schließlich zu einer Kanzlerin Angela Merkel führte?
Grütters: Geißler war damals fast so etwas wie ein Apostel, ein Glücksfall für die C-Partei; er stand für die katholische Soziallehre als politisches Element. Später hat Norbert Blüm das verkörpert. Heute fehlen uns markante Vertreter dieser Haltung.
SPIEGEL: Jens Spahn, indirekt ein Nachfahre Blüms als CDU-Sozialpolitiker, müsste Ihnen doch sympathisch sein: wie Sie katholisch und aus dem Münsterland.
Grütters: Jens Spahn und ich sind uns auch sympathisch. Aber er begründet seine Politik öfter etwas pointierter, als ich es täte.
SPIEGEL: Er hat den Eindruck erweckt, den Hartz-IV-Empfängern ginge es nicht schlecht.
Grütters: Erfolgreiche Politik hat viel mit Empathie zu tun. Die Grundlagen dafür sind bei mir in dem sehr undogmatischen christlich-katholischen Milieu Münsters gelegt worden. Vielleicht würde ich deshalb solche Aussagen so nicht treffen. Ich habe einen tief verwurzelten Respekt vor Menschen in völlig anderen Lebenslagen als meiner eigenen, doch eher privilegierten. Allerdings: Parteien brauchen Strategen, die gezielt Positionierungen vornehmen, um sie hinterher wieder ein Stück weit zurückzunehmen. So steckt man Claims und Ziele ab.
SPIEGEL: Wenn die Sozialpolitiker Geißler und Blüm Ihre Vorbilder waren – warum sind Sie dann in die Kulturpolitik gegangen?
Grütters: Weil ich mich von Anfang an für Literatur, für Kunst und Geschichte interessiert habe. Und dafür, nach grundsätzlichen Zusammenhängen zu suchen und sich nicht nur in der Tagespolitik zu erschöpfen. Das ist kein Widerspruch zum sozialpolitischen Denken.
SPIEGEL: Wie meinen Sie das?
Grütters: Dass die Kulturpolitik in den vergangenen Jahren ganz anders in die Wahrnehmung der allgemeinen Öffentlichkeit gerückt ist, zeigt doch, dass "Kultur" schon lange keine Milieufrage mehr ist, sondern dass hier in einem breiteren Kulturbegriff viele gesamtgesellschaftliche Fragen verhandelt werden. Daraus leiten sich viele, zum Beispiel bildungs- und sozialpolitische, Aspekte ab.
SPIEGEL: Welche?
Grütters: Beispielsweise eine Flüchtlingspolitik, die dem Grundgedanken der Barmherzigkeit verpflichtet ist. Macht endlich Ernst mit dem C in unserem Parteinamen! Deshalb bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in akuter Not grundsätzlich richtig war und dass wir die damit zusammenhängenden Probleme in den Griff bekommen. Schlimmer, als daran zu scheitern, wäre, es gar nicht erst versucht zu haben.
![]() |
Kreuz in Grütters' Büro:
"Ernst machen mit dem C
in unserem Parteinamen" -
FOTO: HANNES JUNG / DER SPIEGEL |
SPIEGEL: Wir sitzen hier in Ihrem Büro mit Blick auf das Kreuz an der Wand. War es klug vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, ein Kreuz für jede bayerische Amtsstube zu verordnen?
Grütters: Jemand, der das Bekenntnis nicht mehr so gewohnt ist und dem es nicht selbstverständlich zur Haltung geworden ist, neigt im Bekenntnisfall auch mal zu Übereifer und Unbeholfenheit. Man kann über die Amtszimmer das Kreuz nicht wieder in die Herzen der Menschen verpflichten. Ich finde, der Gebrauch zum Zwecke der Politik ist nicht nur fatal, sondern gefährlich. Das entwertet das Kreuz.
SPIEGEL: Ist die christliche Partei überhaupt noch christlich?
Grütters: Zumindest fehlt manchmal das ausdrückliche Sichbesinnen, die Berufung auf eine solche Tradition und auf zentrale Begriffe wie zum Beispiel Nächstenliebe. Die Empfehlung zu Toleranz und Friedfertigkeit, die Offenheit für Vielfalt – das alles sollte schon eine praktische und konkrete Relevanz haben. Und hat es in Ansätzen ja auch. Denn in unserer Fraktion gibt es sehr wohl Mitglieder, die den Familiennachzug auch für subsidiär Geflüchtete richtig finden. Der Stellenwert von Kindern und Familien ist in unserem Menschenbild eben nicht nur auf Deutsche beschränkt.
SPIEGEL: Die Revolte des Jahres 1968 hat eine Säkularisierungswelle ausgelöst, die dazu geführt hat, dass die christlichen Bezüge weitgehend verschwunden sind.
Grütters: Eine noch größere Säkularisierung hat die DDR bewirkt. Da war sie wirklich einmal Weltspitze. In Berlin wohnen nur noch neun Prozent Katholiken. Im Westen hat man damals auch mit der etwas muffig wirkenden Selbstdarstellung der Kirchen gebrochen. Ich bin Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also der Laienorganisation, und meine, manche Würdenträger in der Amtskirche haben auch heute noch Bedarf, sich offener, pragmatischer, dem Leben näher darzustellen. Aber die Priester in den Gemeinden vor Ort sind zum Glück oft sehr wohltuende Seelsorger, und auch Papst Franziskus strahlt das aus.
SPIEGEL: Auch der katholischen Kirche fehlt manchmal das Christliche.
Grütters: Ich habe zeit meines Lebens gute Erfahrung mit geistlicher Begleitung gemacht. Aber ich nehme an, Sie sprechen von Missbrauchs- und Korruptionsfällen. Das erschüttert uns alle. Es geht auch um Demut. So hat es schon beim Zweiten Vatikanischen Konzil lateinamerikanische Bischöfe gegeben, die forderten, kein Priester solle reicher leben als seine Gläubigen, auch sollten Laien die Gemeindefinanzen mitverwalten. Das waren wertvolle Anregungen auch für Deutschland. Heute diskutieren wir auch energisch über das Diakonat der Frau.
SPIEGEL: Auch über Priesterinnen?
Grütters: Da sollte man die Traditionalisten nicht überfordern. Aber ohne die Frauen an maßgeblicher Stelle wird es diese Kirche irgendwann nicht mehr geben.
SPIEGEL: Sie haben sich als Frau in einer Männerwelt durchgesetzt, das gilt vor allem für Ihre Zeit in der West-Berliner CDU. Bezeichnen Sie sich als Feministin?
Grütters: Nein, auch nicht als Kampfhenne. Aber ich habe während meiner politischen Karriere sowohl im privaten wie im politischen Bereich gelernt, die Frauenfrage nach oben zu rücken. Und: Ich selbst habe mehr als 50 Prozent Mitarbeiterinnen, in einigen Bereichen sogar mehr als 60 Prozent.
SPIEGEL: Also befürworten Sie die Quote?
Grütters: Je nachdem, wo man sie anwendet. Man kann bei der CDU keine Quote von 50 Prozent einführen, wenn wir 26 Prozent weibliche Mitglieder haben. Aber bei allen Gremien, für die ich Verantwortung trage, achte ich auf Parität. Und wir haben bewiesen, dass es in vielen Fällen auch funktioniert. Dabei geht es übrigens nicht nur um Geschlechtergerechtigkeit, sondern vor allem um eine Vielfalt der Perspektiven.
SPIEGEL: Aus welchem Antrieb heraus? Weil Sie die vorherige Situation als ungerecht empfanden?
Grütters: Weil ich es falsch finde, auf das Potenzial der Frauen zu verzichten. Bei den Gremien im Filmbereich zum Beispiel kann sich keiner herausreden, es gäbe diese Frauen nicht. Es gibt sie. Deshalb haben wir auch das Filmförderungsgesetz geändert, zugunsten einer stärkeren weiblichen Präsenz in Gremien.
SPIEGEL: Viele Männer reagieren auf solche Veränderungen allergisch.
Grütters: Klar – einige denken, dass wir ihnen etwas wegnehmen. Dass sie es so empfinden, lässt tief blicken. Sie haben schließlich keinen Anspruch auf Macht und Einfluss. Außerdem wissen wir doch inzwischen alle: Gemischte Teams sind erfolgreicher.
SPIEGEL: Im Film- und Fernsehbereich hat man den Eindruck, sexualisierter Machtmissbrauch sei ein strukturelles Problem.
Grütters: Ja, denn die asymmetrischen Machtverhältnisse sind leider typisch für diese Branchen.
SPIEGEL: Wobei im WDR, der zuletzt in diesem Zusammenhang in die Schlagzeilen geraten ist, viele Frauen in Führungspositionen sitzen. Dort regierte lange eine Intendantin, dort arbeiten Chefredakteurinnen. Dort gibt es eine hohe Frauenquote.
Grütters: Sie können auch als Frau in einer sehr großen Institution nicht überall verhindern, dass jemand übergriffig wird. Aber viel zu lange waren Scham und Angst stille Begleiter. Dieses Schweigekartell darf es nicht mehr geben. Und übrigens: Von neun ARD-Intendanten plus Deutsche Welle und Deutschlandradio sind gerade einmal zwei weiblich. In der Zeitungsbranche ist es übrigens auch nicht besser: In Regionalzeitungen sind 95 Prozent aller Chefs Männer. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Auswahl und Aufbereitung der Themen. Und jetzt bestätigt eine aktuelle Studie zu den Vorständen in Dax-Unternehmen, dass Deutschland da Schlusslicht ist.
SPIEGEL: Sehen Sie sich Ihre eigene kulturelle Großunternehmung an, das Humboldt Forum. Da wirken an den wirklich entscheidenden Stellen Männer.
Grütters: Aber nicht ausschließlich, und wir müssen noch wichtige Positionen besetzen, für die wir gezielt Frauen ansprechen werden.
SPIEGEL: Die CDU war vor Merkel von Männern dominiert, von Ausnahmen wie Rita Süssmuth abgesehen.
Grütters: Und die hatte ordentlich zu kämpfen.
SPIEGEL: Waren, als Sie anfingen, sexuelle Übergriffe in der Politik üblich, und man sprach einfach nicht darüber?
Grütters: Ich habe keine erlebt und kann deshalb da nicht mitreden.
SPIEGEL: Haben Sie je davon gehört?
Grütters: Nein, und wenn das ein latenter Charakterzug der damaligen Politik gewesen wäre, wüsste ich es.
SPIEGEL: Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki erwähnte einmal die einschlägige Atmosphäre in der Hauptstadtpolitik. Er wäre – so sagte er 2010 – "vielleicht zum Hurenbock" geworden, wäre er länger in Berlin geblieben.
Grütters: Gott sei Dank gehört er nicht zu unserer Partei.
SPIEGEL: Er schilderte ein parteiübergreifendes Milieu.
Grütters: Das sagt mehr aus über ihn als über die Politik. Allein seine Sprache ist verräterisch. Es bleibt also hoffentlich sein Spezialproblem.
SPIEGEL: Und diese Welt, die er da andeutet, haben Sie nie erlebt?
Grütters: Nein, im Gegenteil. Ich bin von Männern, auch in der Berliner Union, immer gefördert worden. Allerdings nur so lange, bis ich auf Augenhöhe angekommen war. Dann wurde es auch einmal schwierig. Aber das gilt für Männer wie Frauen gleichermaßen. Und klar, es gibt überall auch ziemliche Rüpel.
SPIEGEL: Was meinen Sie?
Grütters: Na, wenn man Sätze hört wie: "Setz dich neben mich, gibt gute Bilder."
SPIEGEL: Heute führen Sie die Berliner CDU an. Könnten Sie sich vorstellen, 2021 für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin zu kandidieren?
Grütters: Es ist für mich eine große Ehre und Herausforderung, auch heute schon meiner Wahlheimat, dieser großartigen Stadt Berlin, in meinem politischen Amt dienen zu können. Wie es weitergeht, wenn ich diese zweite Amtszeit als Kulturstaatsministerin vorangebracht habe, möchte ich in Ruhe entscheiden.
SPIEGEL: Sie schließen eine Kandidatur nicht aus.
Grütters: Entscheiden werden wir das – unabhängig von meiner Person – nicht vor 2020, weil man jeden Kandidaten, jede Kandidatin verheizen würde, wenn man sie zu früh nennt. Für mich ist das ein echtes inneres Ringen.
SPIEGEL: Weil Sie sich ein Leben als Kulturstaatsministerin auch über diese Amtszeit hinaus vorstellen könnten?
Grütters: Gemach, gemach – nun hat ja erst mal meine zweite Amtszeit hier begonnen. Ich habe Ideen, auch Leidenschaften für manche Vorhaben. Und ich bin ungeduldig, das merkt man ja. Deshalb gehe ich mit Eifer an die jetzt anstehenden Aufgaben.
SPIEGEL: Es könnte eine schwierige Amtszeit werden, weil Ihr Vorzeigeprojekt – das Humboldt Forum im Stadtschloss – zur Blamage zu werden droht. Vor langer Zeit wurde beschlossen, dort Schaustücke aus außereuropäischen Kulturen zu präsentieren, aber erst jetzt kommt man darauf, die dazugehörige Kolonialzeit zu thematisieren. Ein wenig zu spät, um glaubwürdig zu sein.
Grütters: Ich nehme unsere Museen anders wahr. Sie wissen viel über unsere Objekte und stellen das dar. Aber das öffentliche Interesse ist – anders als zur Zeit der Dahlemer Ausstellungen – stark gestiegen, gerade auch an den Herkunftsgeschichten aus kolonialen Kontexten. Da hat das Humboldt Forum wie ein Katalysator gewirkt, und zwar schon vor seiner Eröffnung.
SPIEGEL: Der Katalysator waren doch eher die Aktivistengruppen, die ein Umdenken eingefordert haben, die infrage stellten, ob uns überhaupt gehören darf, was da ausgestellt werden soll.
Grütters: Ja, die sind während des Richtfestes sogar zu mir auf die Bühne gestiegen. Und ich habe sie damals schon zum Dialog eingeladen. Das Thema Kolonialismus war lange ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur. Diese Erinnerungskultur ist mir wichtig, nicht weil ich mir einrede, man könnte Menschen läutern, aber man kann sie sensibilisieren für Unrecht.
SPIEGEL: Und dann müssen Sie bei aller Aufarbeitung, bei aller Erinnerungskultur auch noch die Leerstelle im Auge behalten, die von der Rechten bewirtschaftet wird – denken Sie an den AfD-Mann Björn Höcke, der das Holocaust-Mahnmal ein "Denkmal der Schande" nannte. Vernachlässigen wir den Blick auf die positiveren Kapitel der deutschen Geschichte?
Grütters: Warum wollen Sie das gegeneinander ausspielen? Beides gehört zu unserer Geschichte.
SPIEGEL: Einer der Gründungsintendanten Ihres Humboldt Forums hat gesagt, es sei die Kardinalfrage, ob sich das deutsche Selbstbewusstsein ausschließlich auf Schuld und Scham aufbauen solle. Man muss diese Ansicht nicht teilen. Aber wenn man dann sieht, dass die AfD das historische Hambacher Fest des Jahres 1832 kapert und als patriotisches Event neu inszenieren will, stellt sich eben die Frage: Wollen wir die hellen Seiten der Geschichte den Rechten überlassen?
Grütters: Wir waren in den vergangenen 70 Jahren zu Recht mit der Aufarbeitung der monströsen Verbrechen der NS-Diktatur beschäftigt. Das war und ist richtig und absolut notwendig. Aber zur deutschen Geschichte gehören eben auch die positiven Momente, mit denen wir uns in der Vergangenheit durch die Überlagerung der beiden Weltkriege, die von Deutschland ausgingen, schwergetan haben. Im Land Berlin denkt man jetzt über einen neuen Feiertag nach, und mit einem solchen Tag könnte man erinnern an den 18. März 1848, auch an den 17. Juni 1953, den Tag des Arbeiterwiderstandes in der DDR. Oder an die friedliche Revolution von 1989, immerhin das größte Ereignis der jüngeren Geschichte. Bisher ehren wir diese mutigen Anfänge dort ja viel zu wenig.
SPIEGEL: Ausgerechnet die AfD hat den Anspruch auf den Vorsitz des Unterausschusses für Auswärtige Kulturpolitik. Der erste Kandidat, der aufgestellt wurde, ist abgelehnt worden. War das politisch klug?
Grütters: Nun ja, die AfD-Abgeordneten sind jetzt unsere Kollegen im Deutschen Bundestag, und da gibt es Regeln, die wir einhalten. Wenn die AfD also einen Anspruch auf einen Ausschussvorsitz hat, finde ich es schwierig, das zu konterkarieren. Aber auch da hängt, wie so oft, viel davon ab, welche Personen vorgeschlagen werden. Insgesamt gilt jedoch: Wir müssen mit den AfD-Politikern korrekt und regelkonform umgehen, selbst wenn das bei mancher Pöbelei aus der Fraktion schwerfällt.
SPIEGEL: Und wenn der AfD-Politiker Marc Jongen sagt, er wolle den Kulturbetrieb "entsiffen"?
Grütters: Das ist nicht mehr als eine Worthülse, vieles darf man bei denen nicht zu ernst nehmen. Da geht es in erster Linie um Provokation. Aber wir müssen klar Haltung zeigen, wenn es um die Verteidigung einer freien, unabhängigen, auch sperrigen und unangepassten, aber diskursfreudigen Kunst und Kultur geht. Das ist das Lebenselixier unserer aufgeklärten Demokratie. Das gilt auch bei der Diskussion, ob wir wieder zu einem nationalen Kulturbegriff kommen müssen.
SPIEGEL: Und, muss man?
Grütters: Nationale Identität erwächst zuallererst aus dem Kulturleben eines Landes und nicht aus der Dichte eines Autobahnnetzes. Kultur wiederum beruht zum einen auf der Bewahrung des materiellen und immateriellen Erbes, was der AfD vielleicht näherliegt, also von der Bewahrung von Burgen und Schlössern bis hin zu den großen Mythen und Grimms Märchen. Zum anderen geht es aber auch um die Ermöglichung der gesellschaftlichen Avantgarde, die den demokratischen Diskurs am Leben erhält. Hier würde mich ein intelligenter Widerspruch reizen.
SPIEGEL: Kultur funktioniert als demokratisches Therapiemittel nur, wenn sie die Menschen auch erreicht, wenn sie in die Museen gehen. Sie wollen – auch wegen mäßiger Besucherzahlen – die berühmte Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren vielen Museen in Berlin evaluieren lassen, am Ende dürfte ein radikaler Umbau stehen.
Grütters: Es war ja vor rund 60 Jahren so, dass die junge Bundesrepublik eine Entscheidung treffen musste, wie sie mit dem preußischen Erbe umgehen will. Daraus entstand die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Nach mittlerweile sechs Jahrzehnten wollen und müssen wir prüfen, ob alles so bleiben kann und ob die Struktur von damals den Aufgaben von heute noch gerecht wird. Denn es stimmt, es sind oft zu wenige Besucher, es gibt schwierige Hierarchien, es herrscht mitunter noch eher ein Amtsverständnis und zu wenig ein Service- und Dienstleistungsdenken.
SPIEGEL: Die ehemalige Messdienerin Grütters agiert als Staatsministerin mit harter Hand. Sie haben einmal gesagt, es fehle der Mut zur Autorität.
Grütters: Mir hat noch niemand mangelnden Mut unterstellt. Autorität in einem schwierigen Umfeld ist gut und richtig, manchmal auch gerade in dieser kreativen Szene, die ja mitunter eigenwillig und anspruchsvoll sein kann. Aber auch die Fähigkeit zum fairen Ausgleich gehört dazu, ein kommunikatives Talent, Zuneigung und Lust auf die Herausforderung. Man sollte das alles haben.
SPIEGEL: Frau Grütters, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Dieser Text-Beitrag erschien in der SPIEGEL-Ausgabe 22/2018.
_____________________________________
ich gebe es ja ehrlich zu: frau grütters ist meine persönliche nachfolgerin als spitzen-sympathieträger(in) in der eigentlich mir abseits stehenden cdu - nachfolgerin nämlich vom leider ausgeschiedenen bundestagspräsidenten norbert lammert, von heiner geißler, norbert blüm und rita süssmuth ... - auch den ollen biedenkopf fand ich seinerzeit so schlecht nicht - und auch der laschet armin macht bis auf die affäre um seine landwirtschafts-ministerin schulze-föcking eine überraschend positive figur... - für einen cdu-ministerpräsidenten ...
doch schon vor monaten traute ich ihr hier den aufstieg zur bundespräsidentin zu.
und deshalb soll sie sich bitte nicht als parteisoldatin evtl. zur spitzenkandidatur der cdu für die wahlen zur regierenden bürgermeisterin in berlin "missbrauchen" lassen - ihr talent wäre zu schade für einen solchen abschuss-posten angesichts von BER und ähnlichen skandälchen und skandalen.
bundespräsidentin, bundestagspräsidentin, evtl gar bundeskanzlerin - für mich noch weit vor annegret kamp-karrenbauer - das wären so aus meiner sicht die jobs in ihrer augenhöhe ...
hoffentlich sehen die "freunde" in ihrer partei - und sie selbst natürlich - das auch so ... - S!