 |
| S!|photography |
Schläft ein Lied in allen Dingen
Der große Erfolg der Bücher und Zeitschriften über Natur folgt einer neuen Weltsicht, die bei allen Lebewesen Gefühle entdeckt
VON ANDREAS WEBER | DIE ZEIT 08/2018 vom 15.02.2018 | S.42 FEUILLETON
Was, wenn alles ganz anders wäre? Wenn nicht nur Menschen eine Innenwelt hätten, sondern alles, was lebt? Wenn nicht nur Menschen Subjekte wären, sondern auch Bäume, Gräser, Affen und Schmetterlinge?
Bis vor Kurzem galt solche Hoffnung als sentimentale Schwärmerei. Doch heute hat sie sich durch harte Verkaufszahlen den Rang einer ernst zu nehmenden Position erstritten. Die Ahnung, dass wir vielleicht doch nicht inmitten automatenhafter Biomaschinen leben, lässt ein Genre auf dem deutschen Buchmarkt boomen, das noch vor einem Jahrzehnt niemand ernst nahm: das Schreiben über Natur.
Eine bislang nur im anglophonen Sprachraum vertretene Sparte hat auch in Deutschland Bestsellererfolge. Die Klassiker des Genres, von Henry David Thoreau über Roger Deakin bis Gary Snyder, verkaufen sich genauso gut wie Bände über Krähen, Kröten, Nelken und Brennnesseln – Titel, die jeder Literaturagent noch vor Kurzem nur müde belächelt hätte. Vorläufiger Kulminationspunkt des Booms ist Das geheime Leben der Bäume des Försters Peter Wohlleben, das ein echter Weltbestseller geworden ist und seit 139 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Das Genre trifft einen Nerv. Vielleicht, mag sich der Leser denken, schläft ja doch ein Lied in allen Dingen!
Gerade das macht die Eliten skeptisch. Spöttisch. Zynisch. Wer nachliest, was deutsche Rezensenten über Naturliteratur schreiben, fühlt sich an das Verdikt erinnert, das Richard Strauss über Rachmaninows 2. Klavierkonzert fällte: »Gefühlvolle Jauche.«
Naturschönheit? Da waren wir doch schon einmal! Das ist doch Romantik! Und Romantik, das wissen wir, legte den Grundstein für die krassesten Entgleisungen des Denkens. Sie ist der röhrende Hirsch schaler Eigentlichkeit oder schlimmer noch: das Sinnlose, aufgeladen mit Sentimentalität.
Naturverachtung hat sich nicht nur in den Wirtschaftsetagen breit gemacht, sondern auch in den Deputaten des Geistes. Wer in den siebziger, achtziger und neunziger Jahren Geisteswissenschaften studierte, lernte vor allem eins: Natur ist eine Fiktion, ausgedacht von uns Menschen. Bestenfalls ist die Biosphäre eine sinnentleerte Maschine, auf die wir unsere Suche nach Bedeutung projizieren, die aber in Wahrheit kalt und ungerührt bleibt. Wen dennoch das Aufblühen im Frühling rührt, der ist einfach naiv.
Und jetzt das: Millionen kaufen Bücher und Zeitschriften, in denen nicht nur die Begegnung mit anderen Lebensformen als Schlüssel zum eigenen Selbstverständnis ausgekostet wird, sondern diesen anderen Lebensformen sogar Gefühle zugesprochen werden, die den unsrigen kaum nachstehen. Muss das nicht als massive Verdummung bekämpft werden?
Was aber ist, wenn die Verlage, die von der neuen Naturwelle profitieren, recht haben und die Kulturkritik mit ihrem verbreiteten Spott das nicht wahrhaben will? Was, wenn das florierende Nature-Writing die jahrhundertealte Gegenüberstellung des Humanen und der Anderen auflöste und somit eine ganz neue Wirklichkeitssicht einschleuste?
Was sich hinter der naturschwärmerischen Welle abzeichnet, könnte etwas sehr Ernsthaftes sein: das Bild einer Welt, in der wir Menschen unseren Platz wiederfinden. Nicht in der Heimat einer trivialen Idylle, sondern in einer radikalen Gegenseitigkeit, in der auch den nicht menschlichen Mitspielern jene schöpferischen und emotionalen Qualitäten nicht fremd sind, die wir allein für unser eigenes Artmerkmal halten.
 |
| Abb.: Anne ten Donkelaar - aus der Serie "Broken Butterflies" |
Andere Geschöpfe, ob Torfmoose oder Javaner-Affen, teilen, um es mit Hannah Arendt zu sagen, mit uns das »Schicksal der Gebürtigkeit«. Oder wie es eine andere unsentimentale Intellektuelle, die Polin Wisława Szymborska, formuliert, sie werden vom »selben Stern in Reichweite gehalten«. Man könnte sogar Adorno, Feind jeder trüben Eigentlichkeit, bemühen, um die Hingezogenheit zu anderem Leben zu erklären, der sagt: »Liebe ist die Fähigkeit, Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen.«
Wie auch immer: Der aktuelle Boom der Naturbücher und Landlusttitel reagiert auf eine neue kulturelle Eruption. Er folgt den Ergebnissen einer Biologie, die sich wie keine andere Naturwissenschaft gerade selbst neu gebiert. Konzepte, die Biologen noch in den 1990ern so sicher galten wie Newtons Schweregesetz vor dem Einschlag der Relativitätstheorie, sind heute als Altlasten entsorgt.
So ist das einst jedem Schüler eingebläute Dogma, dass die Umwelt niemals die Gene beeinflussen kann, begraben. Mittlerweile weiß man, dass Traumata, die eine Großmutter erlebt hat, noch das Genom der Enkel durcheinanderbringen können. Botaniker entdecken wirklich ein geheimes Leben bei Pflanzen, die fühlen und kommunizieren wie Menschen, nur anders. Zoologen weisen Emotionen heute sogar bei so roboterhaft wirkenden Wesen wie der Erdhummel nach, die sowohl unter Verstimmung leiden wie Euphorie auszudrücken vermag.
Statt zu spotten, sollten wir unseren Blick schärfen: für den splitternden Umbruch, der gerade jetzt, in diesen Tagen, die Wissenschaft vom Leben erfasst. Die Biologie steht vor ihrem Quantensprung, und dieser ist nicht technisch, sondern sentimental. Der Bioforscher ist mit seinen Subjekten auf untrennbare Weise verschränkt. Denn wer Lebewesen erforscht, ist selbst eins. Wer Leben untersucht, spricht auch über sich selbst. Was gestern noch kühle Naturwissenschaft war, wird dadurch zur Biopoetik, zu einer Wissenschaft des Lebens in der ersten Person.
Der Naturbuch-Boom markiert also das Heraufdämmern einer Weltsicht. Diese knüpft einerseits da an, wo Hölderlin, Schelling, Wordsworth und Coleridge im 19. Jahrhundert aufhören mussten, nämlich bei der Idee, dass alles, was eine berührbare Außenseite hat, auch eine empfindsame Innenseite hat, genau wie wir. Andererseits reagiert sie auf die Erkenntnisse der Biologie, die sich vom Maschinenmodell der Natur verabschiedet hat.
In der angelsächsischen Kultur war dieser Boden anders als in Deutschland immer fruchtbar. Dort blieb mit Emerson, Thoreau und Whitman die Romantik bis ins 20. Jahrhundert aktuell. Die Sparten Ökophilosophie und Nature-Writing gehen heute fruchtbar ineinander über, setzen sich mit der Biologie auseinander und probieren neue Kommunikationsformen und eine radikal subjektive Sprache.
Was dort im Werk von Protagonisten wie Rebecca Solnit, Robert MacFarlane und Gary Snyder entsteht, ist eine poetische Wissenschaft des Lebens. Diese ist nicht regressiv, sondern tastende Forschung. Von dieser Forschung hatte sich die deutsche Kultur lange abgeschnitten. Das wird jetzt vorsichtig revidiert.
Es gibt ein wirksames Gegenmittel gegen die deutsche Furcht, dass Nature-Writing und Biopoetik nichts als verträumter Kitsch wären, nichts als ein schaler Aufguss der ersten Romantik. Dieses Gegenmittel ist die Idee, mit der die historischen Romantiker damals stecken geblieben sind, die radikale Konsequenz ihres Denkens, die schnell vergessen wurde. Sie geht so: Wenn die Welt seelenförmig ist, dann ist Seelisches, Ausdruck, Schönheit, ja sogar Identität nicht der Triumph souveräner Subjektivität, sondern ein massiv distribuierter Prozess. Dann ist Sein immer nur Sein durch Teilen. Ein Wesen ist nicht eine Seele, die einen Körper bewohnt wie ein mehr oder weniger schickes Konsumgut, sondern sie ist ein Teil der Welt, der nur blühen kann, wenn andere mit ihm solidarisch sind.
So gesehen ist die Rede von »der Natur« unbedingt zu korrigieren. Sie ist keine feste Größe, sondern ein Gewirr von sowohl lebensspendenden als auch tödlichen Gestaltungsprozessen, die Individuen formen wie Meere ihre Wogen und deren Essenzen sich wieder vermischen. Keiner ist einer, immer sind wir viele (was nicht erst Richard David Precht, sondern schon Goethe behauptet hat). Alles ist unauflöslich vermengt.
Das ganze Lebensreich ist »queer« – gebrochen, widersprüchlich, nicht auf den sauberen Nenner einer Individualität zu bringen. Wir selbst haben in unserem Körper mehr Gene von unseren Darmbakterien als eigene. Ein Fünftel unserer DNA stammt von Viren ab, die vor langer Zeit unsere entfernten Vorfahren umgebracht haben, bis diese das infektiöse Erbgut als etwas Neues, Nützliches eingemeindeten.
Eine solche Sicht auf die Natur und uns selbst würde helfen, den Spott der Gebildeten gegenüber den Naturliebenden und Naturliteraten abzubauen. Auch der Körper ist ein Sprachspiel, aber nicht weil er Fiktion ist, sondern weil alles Körperliche existenzielle Poesie und Bedeutung ist. Das zu sehen ließe uns verstehen, dass wir in einer Welt der graduellen Fremdheit und Verwandtschaft leben und nicht: wir hüben und der Rest drüben.
Auch wir selbst stimmen mit uns nicht zu hundert Prozent überein, mit der Partnerin vielleicht zu sechzig Prozent und mit unserem Hund zu dreißig – Ebenen der Überlappung, aus denen Sinn geschaffen werden kann, der freilich niemals erschöpflich ist.
Auf dieses Argument setzt der Ökophilosoph und Björk-Intimus Timothy Morton in seinem neuen Buch Humankind. Morton, bislang Star-DJ eines wilden Zynik-Slams, stellt die Romantik auf die Füße. Er zeigt: Was uns alle empfindungsfähig macht, ist das Gebrochene, Unperfekte aller biologischen Individualität. Die Welt ist zersplittert, die der Tomaten genauso wie unsere eigene.
Folglich müssten die Texte, welche diese Revolution avant la lettre beschreibt, eigentlich gar nicht Nature-Writing heißen, nicht Natur-Schriftstellerei. Sondern vielleicht »Leben schreiben«, das eigene und das der anderen Lebewesen, die ebenso einen Körper haben, der empfindet und der kaputt gehen kann.
Dieses Leben »zu schreiben« erfordert Mut gegenüber den Zynikern, die Fühlen für uncool halten. An denen arbeitete sich kürzlich eine Studierende im Schreibseminar einer Berliner Universität ab. Sie schämte sich, dass sie in einem poetischen kleinen Aufsatz einen Schmetterling erwähnte, weil das ihrer Meinung nach kitschig sei. Sie unterbrach sich extra, um vor ihrem Fauxpas zu warnen, bevor sie die angeblich kitschige Schmetterlingspassage las.
Und dann fing sie ihren Fehler auf, indem sie unmittelbar danach lakonisch die Dimensionen des gegenwärtigen Insektensterbens umriss. Wer dem exponentiellen Schwinden der Insekten – 80 Prozent der Insektenbiomasse in den letzten zwanzig Jahren – gerade noch entgangen ist, sollte nicht verspottet werden.
Der Schmetterling beschwört etwas ganz anderes: Er ist kein Abgesandter von Mutter Natur, sondern unsere zerbrechliche Freude, die aufflackert, bevor das Leben von der Sachzwangmaschine unter schalen Vergnügungen begraben wird. Das bunte Insekt als Idyll trennt uns ab, der bedrohte Falter vermag uns zu verbinden, auch mit uns selbst. Er erinnert uns an unsere Solidarität mit dem Leben. Und Leben ist das, was sich selbst will, indem es anderes, was auch sich selbst will, zu berühren vermag, zu streicheln, zu verdauen.
»Ich spiele Perlspanner, um die Lebensformen / der ganzen Welt in eine einzige zu bringen. / So dass ich dem Tode antworten kann, wenn er kommt ...« schreibt die dänische Lyrikerin Inger Christensen – auch sie eine der Kräfte hinter dem Comeback der Natur ohne Sentimentalität.
Schmetterlinge, das sind ja die Blüten der Luft, das, was Blumen wären, wenn sie fliegen könnten. Sie sind es, weil sie sich ganz in ihre eigene Verletzlichkeit geben und blind in Kauf nehmen, zu Billionen an Windschutzscheiben und Kühlergrills zu zerschellen, wenn man sie denn noch ließe. In ihnen bildet sich die Einsicht ab, dass wir den anderen brauchen, um blühen zu können, dass wir uns öffnen und den anderen einlassen müssen. Und dass Schönheit etwas ist, in dem die Welt zu unserem Atem wird.
Timothy Morton nennt solche Schönheit in einem kühnen Schlenker, der den Psychoanalyse-Imperator Freud und seinen Vollstrecker Lacan mit einem einzigen Federstrich abhakt, das »Symbiotisch- Reale«: die Sphäre des Lebens, in der jeder des anderen Geist und jeder des anderen Echo ist. Das »Symbiotisch-Reale« ist das, was vom »selben Stern in Reichweite gehalten wird«. Es ist ein dauerndes Sehnen nach mehr Wirklichkeit und ein dauerndes Vergehen in der Wirklichkeit des anderen. Es ist keine Rettung im Idyll, sondern ein machtvolles Gefühl.
Wir können uns in dieser neuen Wirklichkeitssicht noch nicht wirklich zurechtfinden. Aber es ist die Sphäre, welche die Millionen Leser von Peter Wohllebens beseelter Waldwelt wiedererkennen, weil sie in ihr leben. Diese neue Wirklichkeit hat vielleicht nicht die simplistische Form, die solche Waldliteratur manchmal annimmt. Aber sie folgt doch einer Erkenntnis, die der Beginn einer neuen kulturellen Epoche sein könnte, und zwar in jeder Form des Austauschs, auch des ökonomischen: Wir alle, wir verletzlichen Körper, sind durch und ineinander, und dieses Durch- und Ineinandersein ist keine effizient absurrende Mechanik, sondern ein seelisches Geschehen intensivster Betroffenheit.
Was sich da abzeichnet, ist kein Paradies, in dem eine gute Mutter uns an ihre Brust nimmt, wenn wir nur brav Biotope schützen. Es ist ein Begehren, in dem jede Geburt einen Tod voraussetzt, in dem alles, was wir erhalten, von einem anderen erst losgelassen werden musste. Wir sehnen uns danach, zu empfangen, aber auch freizulassen, um zu geben. Wir sind lebendig, und die anderen sind es auch. Aber wir sind es nur miteinander und durch einander, in der Sehnsucht, zu blühen, indem mein Gegenüber blühen darf.
geboren 1967, lebt als Autor und Hochschuldozent in Berlin und Italien. Zuletzt erschien sein Buch »Sein und Teilen« 2017 im transcript Verlag
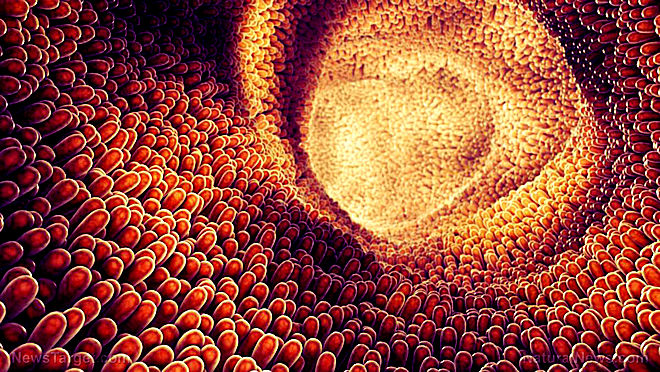 |
| Mikrobiom - nach naturalnews.com |
ich muss meine leser unbedingt teilhaben lassen an diesem text, den ich im neuesten "zeit"-feuilleton fand. also - ganz ehrlich - ich bin ganz überwältigt - ganz hin & weg - von sprache und sinn dieses textes - auch weil es sich mit vielen überlegungen deckt, die ich so vor mich hin ausbrüte - die ich aber nie so prägnant zum ausdruck bringen könnte.
bitte - bitte - lassen sie sich nicht von der länge des artikels abschrecken, ihn auch wirklich ganz zu lesen ...
ich meine - es ist vielleicht ein schlüsseltext - zumindest für mich - der mich anrührt ...
ich habe mich vorgestern ja noch mit dem für mich kaum leserlichen botho-strauß-text vom "anschwellenden boxgesang" von vor 25 jahren beschäftigt. das war so ein text, der trotz seiner intellektuellen verquastheit anscheinend etwas bewirkt hatte - ein "abschlusstext" zum "marsch durch die institutionen" der 68-er vielleicht - sozusagen der schlusspunkt: von jetzt an geht es wieder "rääts heröm" ...
dieser text hier nun vom biologen andreas weber ist da etwas ganz anderes, da wird mir zumindest frische luft zugewedelt mit den flügelpaaren all der schmetterlinge, die noch verpuppt winterschlaf halten, die vielleicht irgendwo jemandem im bauch herumflattern, die im schmetterlingshaus irgendwelcher botanischer gärten herumwedeln ... - und die auf ihren start in den frühling warten ... - immer wieder neu und doch nach dem uralten ritus der individuellen metamorphose ...: ent-wicklung - verpuppung - ent-wicklung usw. ...
wie gesagt - ich bin ganz hin und weg und mir stehen die tränen in den augen: alles kommt vor: die fülle des mikrobioms, mit dem ich mich neulich erst ausführlich beschäftigt habe: sein millionen von jahren währendes alter, das die körper immer wieder neu besiedelt und uns schon im mutterleib teilweise übertragen wird: eine metapher vielleicht für "ewiges leben" ... seine partnerschaft in und zu meinem leib, den ich als gabe erhalten habe ... -
hoffentlich sind diese geschriebenen "natürlichkeiten" nicht nur wieder eine welle, weil in china ein sack reis umgekippt ist, oder der flügelschlag eines schmetterlings einen tsunami ausgelöst hat - eine welle, die nach dem anplanschen auf den sand einfach vergeht und wieder wegsackt. ich weiß noch, als wenigstens in unseren damals esoterisch angehauchten kreisen alle welt zu "rudolf-steiner-vorträgen" schritt: ommmm ... - das hat nach meiner wahrnehmung wieder nachgelassen ...
hoffentlich sind diese geschriebenen "natürlichkeiten" nicht nur wieder eine welle, weil in china ein sack reis umgekippt ist, oder der flügelschlag eines schmetterlings einen tsunami ausgelöst hat - eine welle, die nach dem anplanschen auf den sand einfach vergeht und wieder wegsackt. ich weiß noch, als wenigstens in unseren damals esoterisch angehauchten kreisen alle welt zu "rudolf-steiner-vorträgen" schritt: ommmm ... - das hat nach meiner wahrnehmung wieder nachgelassen ...
tja - da bleibt vielleicht nur ein spätes ehrfurchtsvolles staunen - und das gefühl der geborgenheit in der geborgenheit ... danke - S!
So gesehen ist die Rede von »der Natur«unbedingt zu korrigieren.Sie ist keine feste Größe,sondern ein Gewirr von sowohl lebensspendendenals auch tödlichen Gestaltungsprozessen,die Individuen formen wie Meere ihre Wogenund deren Essenzen sich wieder vermischen.Keiner ist einer, immer sind wir viele(was nicht erst Richard David Precht,sondern schon Goethe behauptet hat).Alles ist unauflöslich vermengt.
noch ein tipp: wenn sie mal in nächster zeit ganz mies drauf sind, dann versuchen sie sich an diesen text zu erinnern - und ihn erneut zu lesen:
ich glaube zu ahnen, dass es danach besser wird ...
