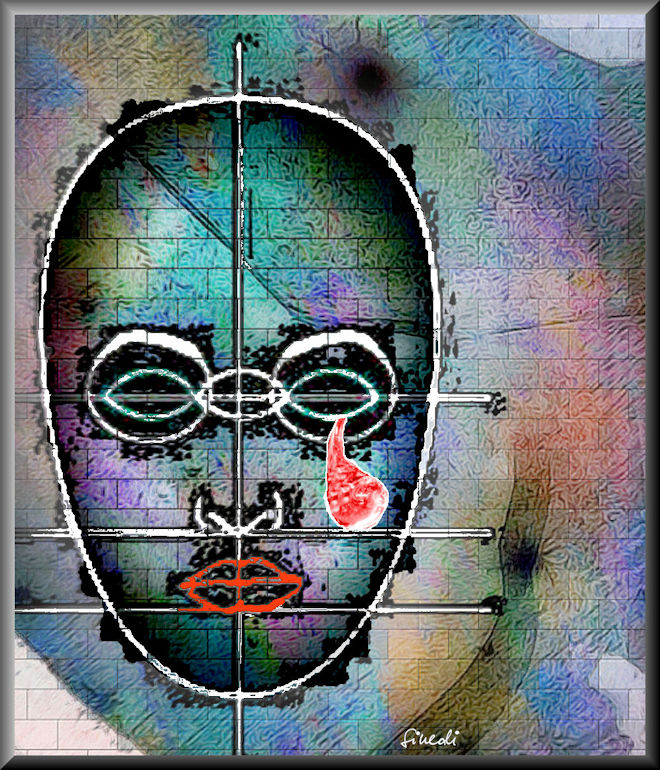|
| und wenn unterm pflaster nun doch noch der strand liegt ... ??? S!|fotocollage |
Der Flohmarkt der Begriffsmoden
Ob «Entfremdung», «System» oder «Chaos»: Die Avantgarde der Wissenschaft steht meist im Zeichen einer magischen neuen Sprache. Was als Begriffshype beginnt, endet in Erschöpfung und Vergreisung. NZZ-Gastkommentar von Peter Strasser
Man muss nur lange genug in einer Begriffsmanufaktur namens «Wissenschaft», besonders den Begriffsproduktionszweigstellen namens Geisteswissenschaften, arbeiten, um sich immer wieder einmal verwundert umzuschauen: War da nicht mal etwas?
Erst kürzlich ist mir aufgefallen, dass keine meiner Studentinnen (Studenten eingeschlossen) eine Ahnung davon hatte, was der «Positivismusstreit» gewesen ist. Ich hingegen gehörte einer studentischen Generation an, für die Begriffsmarker wie «instrumentelles Apriori» und «repressive Toleranz» einen Rahmen bereitstellten, mit dem man dachte, die Welt nicht nur erklären, sondern auch verändern zu können. Das politische Klima war «links», unter dem Pflaster lag der Strand, man verschlang die Bücher der Frankfurter Schule. Von einer «emanzipatorischen Vernunft» war die Rede, denn die naturwissenschaftliche Intelligenz wurde verdächtigt, dem «System» zuzuarbeiten. Neomarxistisch gesprochen, hiess das Fachwort: «Entfremdung».
Schwungräder der Ideen
 Was blieb von unseren subversiven Begriffsträumereien im Elfenbeinturm? Antwort: Kaum frequentierte Archive, verstaubte Diplomarbeiten ungeheuren Umfangs, das Gefühl des Raschelns von totem Papier.
Was blieb von unseren subversiven Begriffsträumereien im Elfenbeinturm? Antwort: Kaum frequentierte Archive, verstaubte Diplomarbeiten ungeheuren Umfangs, das Gefühl des Raschelns von totem Papier.Während die Subversionsrhetorik der akademischen Gesellschaftskritiker von findigen Reformpolitikern aufgenommen, abgeschwächt und neutralisiert wurde, faszinierte bald ein neues Fachvokabular. Als ich in den neunziger Jahren konzeptgebender Beirat des damaligen Avantgardefestivals Steirischer Herbst wurde, hatte gerade der Wissens- und Kunst-Tausendsassa Peter Weibel ein Symposium zum Thema «Chaos» ausgerichtet. Die Crème de la Crème der chaostheoretischen Meisterdenker war anwesend, es ging um die Sprengkraft eines Begriffs, der damals auch in der Soziologie zu den meistverwendeten gehörte: «Autopoiesis» – ein Schwungrad, das die Ideenproduktion chilenischer Neurobiologen (Maturana, Varela) ebenso belebte wie die deutschsoziologische Systemtheorie (Luhmann).
Einer staunenden Öffentlichkeit wurde bekanntgemacht, dass sich alles Leben, auch alle soziale Praxis, aus «selbstregulativen» Strukturen aufbaue, die ihre je eigenen Codes hätten und ineinander unübersetzbar – «inkommensurabel» – seien. Das Wort vom «radikalen Konstruktivismus» wurde zu einem Dauerbrenner, denn in ihm steckte die regelrecht weltschöpferische Vision, dass wir unsere Wirklichkeit selbst erzeugten.
Hinzu kam das Faszinationswort «Chaos», es folgten «Zufall» und «Apfelmännchen», eine ganze, schlecht oder gar nicht verstandene Begriffsoffensive, worin neue Freiheitsräume und ästhetische Kompositionsgesetze zu schlummern schienen. Und rasch war einem faszinierten Publikum auch bekannt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings hierorts einen Tsunami auf der anderen Seite der Erdkugel auslösen könne, was bedeutete, dass alles mit allem im Grunde zusammenhing. Das globale ökologische Denken war im Ursprung «spirituell».
Mein Avantgardefestival prägte die Formel «Nomadologie der Neunziger», einem Konzeptchic verpflichtet, nämlich dem des «nomadisierenden Subjekts», wie es von den Franzosen Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem «Anti-Ödipus» (1972/80) proklamiert worden war. Das humanistische Selbstverwirklichungsdenken galt fortan als reaktionär. «Posthumanistische» Begriffe eroberten die Seminare. Der Mensch – ein «Multischizo», eine «Wunschmaschine». Als Signalmetapher machte das «Rhizom» Furore, eine Wurzelart, die sich horizontal ausbreitet, ohne «phallische» Austriebe (Bäume!). Ein später Nachzügler dieses französischen Sprachdeliriums war, regelrecht bieder, Richard David Prechts Bestseller «Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?» (2007).
Das sind nur einige Bespiele für Fachbegrifflichkeiten, deren Erfolg an der Vorstellung hing, die Welt neu erfahren, neu strukturieren und unser Gefühlsleben neu beleben zu können. In den Begriffen steckte, unschwer erkennbar, auch ein Nachwirken religiöser Bedürfnisse, weshalb die jeweiligen «Väter»– es waren in der Regel Männer – der jeweils neuesten Universaltheorie geradezu den Rang von Gurus einnahmen. Aus ihrer geistigen Höhe floss das Begriffsmanna, von dem sich der Durchschnittsdenker (die Denkerin eingeschlossen) nährte.
 |
| Peter Strasser | S!|bearbeitung |
So sind wir, ehemals Begriffswildfänge, alt geworden. Es ist eine Ernüchterung, die in den Geisteswissenschaften zu einer Abwertung grosser Begriffsentwürfe führte. Aus den hochfliegenden «Paradigmen» sind zusehends Schulen geworden, die ihre Art der Scholastik in eigenen Zeitschriften, «journals», pflegen. Dort erhalten nur «papers» Zutritt, die sich eines regulierten Sprach- und Denkstils bedienen, ob strukturalistisch, feministisch oder sprachanalytisch. Die Verengung und Verhärtung, die nicht selten bis zur theoretischen Borniertheit geht, mag zur Wirklichkeitsverweigerung führen. Dies demonstrierte exemplarisch jene bereits klassische Schwindelei des New Yorker Physikers Alan Sokal, der in einem hochqualifizierten, «peer-reviewten» Journal namens «Social Text» 1996 eine feministische Quantenphysik publizierte, deren Unsinn die «poststrukturalistische» Diskursverriegelung offenbarte.
Jene,
welche die Dinge weiterhin
aus dem Blickwinkel
von einst sehen,
begegnen uns als
schrullige Zeitverächter.
Doch Offenheit garantiert nichts dauerhaft Seriöses. Da wir im Zeitalter der totalen Digitalisierung leben, finden sich Hunderte und Aberhunderte von Internetportalen, in denen das Räsonnement längst zu pseudowissenschaftlichen Theorieverschnitten aus allen möglichen Quellen verkam, zusammengestoppelt aus – sagen wir –«The Big Bang Theory», «Quantenvakuum», «anthroposophischer» Esoterik und Dan Brownscher Kryptografie zur Lösung der letzten Welträtsel.
Dieser Tendenz zur Begriffsverwilderung – und dem damit einhergehenden Hang zum Rückfall in voraufgeklärte Sichtweisen, deren jeweils aktuelle meist kaum eine Saison überdauert – steht das seriöse Spektrum der Anwendung von Fachbegriffen gegenüber. Doch auch hier ist, aufgrund des raschen Umlaufs neuer Sprachspiele, eine rasche Einebnung des Neuigkeitswertes zu beobachten. Dass wir in einer «Risikogesellschaft» (Ulrich Beck) und dabei «postdemokratisch» (Colin Crouch) ausgerichtet leben, ist uns ebenso prompt geläufig geworden wie der neueste Begriffsumstand, wonach unsere moderne Weltbeziehung unter «gestörter Resonanz» leidet (Hartmut Rosa).
Teil eines Erregungsspiels
An die Stelle der Vergreisung von Fachsprachen ist ihre rasche Trivialisierung getreten, vor der Resonanzlähmung der soeben noch resonanten Begriffe. Es ist wieder alles, wie es ist. Kein Wunder, dass sich unter den Jungen, sei’s herrisch, sei’s romantisch, der Wunsch nach einer Direktheit im Umgang mit den Sachen meldet – eine Direktheit, die für den Realitätsfilter des «Expertenkauderwelschs» nur Hohn übrig hat.
Was nun die Begriffsinnovationen speziell in den Denkwerkstätten der hohen Schulen, der Universitäten, angeht, so ist noch ein typisches Phänomen zu beobachten: die Denkkollektivierung. Waren es im 19. und in einem Teil des 20. Jahrhunderts grosse Denkergestalten, die beim Aufbau neuer Begriffswelten und damit auch origineller Weltsichten massgeblich den Ton angaben, so sind nun die «Teams» an der Reihe. Diese rudeln sich rund um «Projekte» zusammen, die häufig interdisziplinär angelegt sind. Das hat weniger mit internen Forschungsbedürfnissen als mit Finanzierungsmodalitäten zu tun. Für grosse, weitgestreute Projekte fliesst über längere Zeit eben mehr Geld aus den Forschungsfonds.
Die Folge der Kollektivierung innovativer Köpfe ist indes eklatant: Es fehlt zwar nicht an Originalität, doch die fachspezifischen Neuerungen werden rasch routinisiert, und die Fachbegriffe funktionieren wie Duftmarken. Es kommt immer mehr auf die «conceptual skills» im Team an, für dessen netzwerkartige Interaktionen die sprachliche Ausdrucksform wesentlich ist, oft wesentlicher – warum es nicht offen ansprechen? – als das vorhandene Erkenntnispotenzial. Man ist ein wenig an die Unrast in einem Ameisenhaufen erinnert.
Das ist der Grund, warum grössere Forschungsproduktivität mit einer Tendenz zur Gleichschaltung origineller Köpfe erkauft wird. Im universitären Normalbetrieb zieht das Veralten eines «Forschungsparadigmas» zumeist keine Erkenntniskrise nach sich; immer stehen zukunftsweisende Projekte bereit, welche oft anmuten wie der alte Wein in neuen Schläuchen. In der heutigen Teamhaltung wird, um Nietzsches Sprache zu verwenden, der Wille, «einen neuen Stern zu gebären», eher belächelt oder als Affront gegen den Teamgeist empfunden.
Für die «interessierte» Öffentlichkeit, die laufend über neue wissenschaftliche Erkenntnisse informiert wird (und seien es nur haltlose Spekulationen hinsichtlich der letzten Weltbausteine), ist das Veralten von Begrifflichkeiten Teil eines Erregungsspiels. Der Neuzufluss von modischen Terminologien, ob in der Astrophysik oder der Alternativmedizin, hilft darüber hinweg, dass sich schon längst keine neuen, aufregenden Weltsichten mehr auftun. Der Reiz von Verschwörungstheorien und Fake-News ist an die Stelle jener Faszination getreten, die einst wissenschaftliche Revolutionen auslösten.
Kurz: Die technisch so innovative Welt ist existenziell alt geworden. Es braucht also Medien, die uns durch die Stäbe des Käfigs unserer Innerweltlichkeit in aufregende andere Sphären blicken lassen. Das allerdings ist weniger eine Leistung neuer Weltkonzepte als vielmehr der Phantasmagorien eines digitalen Universums, in dessen virtuellen Weiten wir uns verlieren können, während die Tatsachen sind, was sie sind. Nein, unter dem Pflaster liegt kein Strand mehr.
Peter Strasser ist emeritierter Universitätsprofessor, er unterrichtet Philosophie an der Universität Graz. 2017 ist bei Fink erschienen: «Idioten des Absoluten. Über das Weltfremde in uns».
hier sind einige begriffe aufgezählt, mit denen ich in meinen weiterbildungskursen konfrontiert war - und die ich nur mühsam "begreifen" lernte. trotzdem habe ich heute nicht das gefühl, als seien das alles nur "sprachspielereien" gewesen. mir jedenfalls hat z.b. die konstruktivistische denkweise ganz neue wahrnehmungen "beschert" - und viele "aha's" ... und wenn es nur das war.
ansonsten heißt es ja schon im faust I von goethe - immerhin schon von 1808:
ansonsten heißt es ja schon im faust I von goethe - immerhin schon von 1808:
Nenn's Glück!
Herz!
Liebe!
Gott
Ich habe keinen Namen Dafür!
Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut.
S!