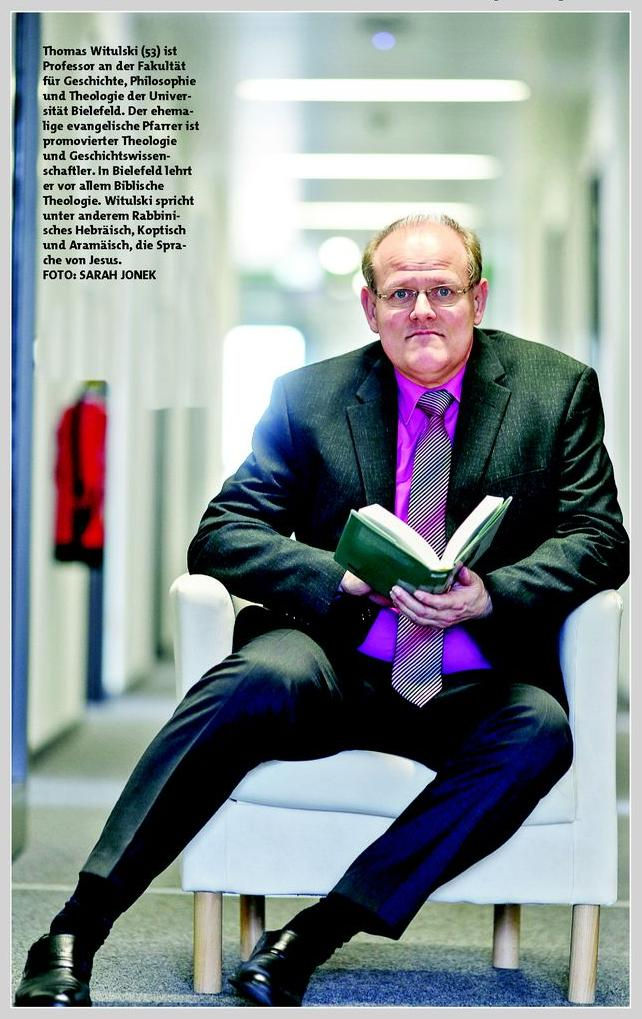Wissen - DIE ZEIT No. 14 | S. 33/34 · Josephina Maier, Jan Schweitzer
21 000 getötete Patienten pro Jahr. Kann das stimmen?
Diese Horrorzahl wurde gerade in die Welt gesetzt. Wo sie herkommt, was dran ist – wir haben den Urheber gefragt
»21 000 getötete Patienten pro Jahr in deutschen Krankenhäusern und Heimen?« Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Sachbuch mit solchen Worten angekündigt wird. Der Verlag Droemer verschickte für Ende März eine Einladung mit dieser Formulierung. Sie sollte auf das neue Buch »Tatort Krankenhaus« hinweisen, in dem von dieser Zahl die Rede ist – und das am Mittwoch dieser Woche in einer Diskussionsveranstaltung mit dem Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) vorgestellt werden sollte. Wir verabredeten uns vorab mit Karl H. Beine, der das Buch zusammen mit der Journalistin Jeanne Turczynski geschrieben hat, in seinem Büro am St. Marien-Hospital in Hamm. Er ist dort Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Beine lehrt zudem als Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke.
ZEIT: Herr Beine, Sie haben inzwischen Ihr drittes Buch über Tötungen im Krankenhaus geschrieben. Warum beschäftigt dieses Thema Sie so sehr?
Beine: Ich habe in den neunziger Jahren in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, in der ein Krankenpfleger überführt wurde, der Patienten getötet hat. Diesen Pfleger kannte ich, und einen Patienten, den er umgebracht hat, kannte ich auch. Das hat mich damals tief bewegt.
ZEIT: In Ihrem neuen Buch schreiben Sie, in Krankenhäusern und Heimen könnte es zu mehr als 21 000 Tötungen gekommen sein – in einem Jahr. Wie kommen Sie auf eine so große Zahl?
Beine: Mehr als 5000 Ärzte und Pfleger in ganz Deutschland haben einen Fragebogen ausgefüllt, auf dem unter anderem diese beiden Fragen standen: »Haben Sie selbst schon einmal aktiv das Leiden von Patienten beendet?« Und: »Haben Sie in den vergangenen zwölf Monaten schon einmal von einem oder mehreren Fällen gehört, bei denen an Ihrem Arbeitsplatz das Leiden von Patienten aktiv beendet wurde?« Aus den Antworten haben wir diese Zahl errechnet.
ZEIT: Wie haben Sie die Teilnehmer der Befragung ausgewählt?
Beine: Wir haben alle Krankenhäuser und Pflegeheime in Deutschland angeschrieben, per Mail und per Post.
ZEIT: Das heißt, die Leute haben selbst entschieden, ob sie an der Umfrage teilnehmen. Und sie wussten auch, worum es im Fragebogen geht?
Beine: Ja.
ZEIT: Dann liegt es nahe, zu unterstellen: Klinikangestellte, die solche Fälle mitbekommen haben und sich darüber Sorgen machen, nehmen eher an der Befragung teil. Könnte das nicht zu einer Verzerrung führen?
Beine: Ja, diese Gefahr besteht. Aber das ist bei Befragungen immer so. Über diejenigen, die nicht geantwortet haben, lässt sich trefflich spekulieren.
ZEIT: Sie kommen, ausgehend von Ihrer Befragung, auf 14 461 Tötungen in Krankenhäusern und 6857 Tötungen in Heimen. Wie genau sind Sie zu diesen Zahlen gelangt?
Beine: Wir haben die Ergebnisse aus den Fragebögen auf die Gesamtzahl der in Krankenhäusern und in Pflegeheimen tätigen Krankenpfleger, Altenpfleger und Ärzte bezogen.
ZEIT: Das heißt, Sie haben die Stichprobe behandelt, als sei sie repräsentativ.
Beine: Nein, wenn ich das getan hätte, dann hätte ich das als Hochrechnung bezeichnet, nicht als empirische Schätzung. Darauf wird im Buch ausdrücklich hingewiesen. Deshalb stehen die Aussagen über die Zahl der Tötungen auch überall im Konjunktiv. Und es heißt ausdrücklich, dass sich hinter »aktiv beenden« sehr unterschiedliche Tötungsdelikte verbergen können.
Beine: Das kann ich nicht ausschließen. Unsere Fragen lassen sicher einen Interpretationsspielraum. Aber: »Aktives Beenden« ist in meinen Augen etwas anderes als Beihilfe zum Suizid oder die Behandlung von Schmerzen, wenn dabei unbeabsichtigte Nebenwirkungen auftreten, die den Sterbevorgang verkürzen.
ZEIT: Was glauben Sie: In wie vielen der 21 000 Fälle ging es um passive Sterbehilfe?
Beine: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
ZEIT: Die deutliche Mehrheit?
Beine: Ich würde mich da ungern festlegen. Wie häufig die spezifische Kombination aus Persönlichkeitsmerkmalen und Arbeitsbedingungen wirklich zu einer Tötungsserie führt, können wir auch jetzt nicht sagen. Da muss weiter geforscht werden. Aber immerhin sind in den vergangenen Jahren allein im deutschen Sprachraum zehn Tötungsserien bekannt geworden. Außerdem bin ich in den vergangenen 25 Jahren häufiger um Beratung bei suspektem Verhalten gebeten worden. Erst Anfang März 2017 hat ein Altenpfleger aus Rheinland–Pfalz gestanden, dass er eine Heimbewohnerin getötet hat. Aus all diesen Gründen fällt es schwer, die Behauptung von den Einzelfällen aufrechtzuerhalten.
ZEIT: Warum haben Sie im Fragebogen die Formulierung »Haben Sie selbst schon einmal aktiv das Leiden von Patienten beendet?« verwendet und nicht geschrieben »das Leben beendet«?
Beine: Weil es ein besonders schwieriges Thema ist. Ich konnte ja nicht fragen: »Haben Sie schon einmal einen Patienten getötet?« Die Fragestellung führt dazu, dass man etwas mehr erfährt, obwohl die Formulierung Interpretationsspielraum bietet.
ZEIT: Aber war es nicht Ihr Anliegen, vorsätzliche Tötungen aufzudecken? Mit dem Begriff »Leiden« haben Sie wahrscheinlich, wie Sie selbst sagen, eine große Zahl von Menschen miterfasst, die keine aktive Tötung begangen, sondern passiv Sterbehilfe geleistet haben. Situationen, über die wohl viele sagen würden: Das kann man nachvollziehen. Wenn Sie nach »Leben beendet« gefragt hätten, wären Sie wahrscheinlich zu einer viel kleineren Zahl gekommen.
Beine: Ich hätte womöglich gar keinen Rücklauf bekommen. Hinter der Entscheidung für die Formulierung steht eine pragmatische Abwägung, wir haben lange darüber beraten.
ZEIT: Sie hätten im Buch auch die Zahl der Pfleger und Ärzte nennen können, die in Ihrer Stichprobe mit Ja geantwortet hat. Wieso haben Sie überhaupt hochgerechnet?
Beine: Ich habe die Zahlen nicht als Hochrechnung deklariert, sondern als empirisch basierte Schätzung. Das habe ich getan, um die These zu erschüttern, dass es sich um Einzeltaten handelt. Genau diese These wird immer wieder vorgetragen von den Verantwortlichen aus der Selbstverwaltung und aus der Politik. Das bedarf der Überprüfung, das müssen wir weiter erforschen. Darum geht es mir.
ZEIT: In der Ankündigung zu Ihrem Buch steht: »Tausende Patienten bezahlen das mit ihrem Leben.« Auf der Verlagsseite steht, dass Sie und Ihre Co-Autorin »einen Skandal von ungeheurem Ausmaß« aufdecken.
Beine: Das ist die Pressemeldung für das Buch, für das wir stehen.
Beine: (überlegt) Ja. Das stimmt schon: Ich will darauf hinweisen, dass es in unserem Gesundheitssystem an dieser Stelle ein Problem gibt, auf das wir sehr genau achten müssen.
ZEIT: Wenn man als Laie diese Zahl sieht, 21 000 Getötete, da bekommt man doch Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Was würden Sie einem Leser raten?
Beine: Die Augen offen zu halten. Auf die Atmosphäre zu achten. Wie sprechen die Ärzte und Pfleger mit ihm? Sprechen sie überhaupt mit ihm? Er sollte sich darauf einstellen, dass Angestellte in Krankenhäusern extrem gestresst und genervt sein können. Und sich umhören, welche Klinik andere ihm empfehlen.
ZEIT: Was antworten Sie, wenn ein Leser fragt, ob er Angst haben muss, in eine Klinik zu gehen?
Beine: (langes Schweigen) Ich würde sagen, du musst keine Angst haben, aber pass auf.
ZEIT: Über diese Frage mussten Sie jetzt lange nachdenken.
Beine: (sehr energisch) Ja! Weil ich abwägen musste, wie viel ich gesehen und gehört habe in all den Jahren – und welche Konstellationen ich kenne. Die Angst sollte nicht so groß sein, dass man sich als Patient medizinisch notwendigen Eingriffen in Krankenhäusern nicht unterzieht. Aber die Patientensicherheit ließe sich eben noch deutlich verbessern. Das fängt bei verbalen Grobheiten und Behandlungsfehlern an und kann im Extremfall mit medikamentös herbeigeführten Todesfällen enden. Deshalb plädiere ich im Buch für Patientenschutzbeauftragte in den Kliniken.
Bei dieser Antwort erhebt Beine zum ersten Mal die Stimme. Vielleicht realisiert er erst jetzt, dass die Zahl, die er da in die Welt gesetzt hat, vielen Patienten einfach Angst machen könnte.
ZEIT: Missstände gibt es nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Verbale und körperliche Gewalt kommt auch in der häuslichen Pflege vor, zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Deutschland werden ja zu Hause versorgt. Wo sollen sich Patienten und Pflegebedürftige überhaupt noch sicher fühlen?
Beine: Es gibt meines Wissens keine empirische Studie über häusliche Gewalt gegen Pflegebedürftige, aber auch da hören wir immer wieder von spektakulären Einzelfällen, ohne das Dunkelfeld zu kennen. Letztlich wissen wir nicht, wo der sicherere Ort ist.
ZEIT: Sie haben die Ergebnisse Ihrer Befragung nicht in einem Forschungsjournal publiziert, wo sie vor der Veröffentlichung von Fachkollegen geprüft worden wäre, sondern in einem populären Sachbuch für das breite Publikum. Wieso? Weil Sie auf diesem Weg am meisten Menschen erreichen?
Beine: Ja, ich erreiche dadurch mehr Leute – und das wollte ich auch. Dieses Anliegen habe ich, und ich sehe mein Buch als Debattenbuch. Ein Teil des Datensatzes ist übrigens wissenschaftlich aufbereitet worden und bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift zum Peer-Review eingereicht.
Beine: Die Politik muss gesetzlich sicherstellen, dass genug Ärzte und Pfleger für die Behandlung und Betreuung der Patienten vorhanden sind. Außerdem müssen wir die Zahl der Kliniken reduzieren. Im Moment nehmen viele Häuser Eingriffe vor, für die sie gar nicht geeignet sind. Das Problem, dass wir zu viele Krankenhäuser haben, soll offensichtlich über den Wettbewerb gelöst werden: Irgendwann ist ein Haus pleite. Aber bis es so weit ist, rüsten die Kliniken technisch immer weiter hoch, in der Hoffnung, dass es den Konkurrenten früher trifft. Und wir brauchen eine andere Fehlerkultur.
ZEIT: Können Sie das genauer ausführen?
Beine: Es darf kein Wettbewerbsnachteil für Kliniken sein, wenn dort offen über Fehler gesprochen wird, im Sinne von »Das ist nicht gut für unser Haus«. Wir müssen die zukünftigen Pfleger und Ärzte schon in der Ausbildung ermuntern, Fehler zuzugeben. Sie müssen verstehen, dass das keine Schwäche ist, sondern ein Akt von Souveränität. Ein Chef darf nicht auf denjenigen einprügeln, der etwas falsch gemacht hat. Egal, wie schlimm die Folgen des Fehlers sein mögen: Es muss klar sein, dass es besser ist, offen darüber zu sprechen, als ihn zu vertuschen.
ZEIT: Sie sind selbst Chefarzt. Was können Vorgesetzte dazu beitragen?
Beine: Für mich ist ein zentraler Punkt: Vorgesetzte müssen sich wirklich dafür interessieren, wie es ihren Mitarbeitern und den Menschen geht, die von ihnen versorgt werden. Damit nicht diese Laisser-faire-Stimmung entsteht, wo die Leute das Gefühl haben: Es ist egal, was wir hier machen, das kriegt ohnehin keiner mit.
ZEIT: Sie plädieren in Ihrem Buch dafür, dass angehende Mediziner und Pfleger besser ausgewählt werden sollen. Gleichzeitig kritisieren Sie, dass es nicht genug Personal gebe. Das ist ein Widerspruch.
Beine: Ich hoffe, dass das Krankenhaus als Arbeitsplatz für Ärzte und vor allem Pfleger wieder attraktiver wird, wenn wir Kurskorrekturen am Gesundheitssystem vornehmen. Wenn Medizin und Pflege weniger durch wirtschaftliche Zwänge dominiert werden, schafft das Gestaltungsspielraum, und das ist es, was an diesen Berufen eigentlich Freude macht.
ZEIT: Am Ende des Buches steht der ehrliche Satz: Wir werden uns nicht jede Technik und alle Medizin zu jedem Preis für alle leisten können. Woher soll das Geld kommen für die Maßnahmen, die Sie fordern?
Beine: Wir haben in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zum Beispiel zu viele Implantationen von künstlichen Hüftgelenken, zu viele Rückenoperationen und Kniegelenkspiegelungen. Weil diese Eingriffe den Krankenhäusern Geld bringen. Wenn man dafür sorgen würde, dass sie wirklich nur durchgeführt werden, wenn sie medizinisch sinnvoll sind, hätten wir sicher kein Geldproblem. Ich bin davon überzeugt, dass unserem Gesundheitswesen alles Mögliche fehlt, aber kein Geld.
Nach dem Gespräch mit Karl Beine ist aus unserer Sicht klar: Die Zahl, die uns zu ihm geführt hat, lässt sich so nicht halten. Andererseits treibt den Buchautor ein Anliegen um, das wir nachvollziehen können. Er will auf Missstände im Gesundheitssystem aufmerksam machen. Und die gibt es ohne Zweifel. Der Weg, den er dafür gewählt hat, ist unserer Meinung nach der falsche.
![]() wir dürfen bei solchen horror-zahlen nicht äpfel mit birnen verwechseln. natürlich ist angesichts der apparate-medizin im computer-zeitalter dem arzt - aber auch den nahen anverwandten - eine große verantwortung übertragen:
wir dürfen bei solchen horror-zahlen nicht äpfel mit birnen verwechseln. natürlich ist angesichts der apparate-medizin im computer-zeitalter dem arzt - aber auch den nahen anverwandten - eine große verantwortung übertragen:
21 000 getötete Patienten pro Jahr. Kann das stimmen?
Diese Horrorzahl wurde gerade in die Welt gesetzt. Wo sie herkommt, was dran ist – wir haben den Urheber gefragt
»21 000 getötete Patienten pro Jahr in deutschen Krankenhäusern und Heimen?« Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Sachbuch mit solchen Worten angekündigt wird. Der Verlag Droemer verschickte für Ende März eine Einladung mit dieser Formulierung. Sie sollte auf das neue Buch »Tatort Krankenhaus« hinweisen, in dem von dieser Zahl die Rede ist – und das am Mittwoch dieser Woche in einer Diskussionsveranstaltung mit dem Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) vorgestellt werden sollte. Wir verabredeten uns vorab mit Karl H. Beine, der das Buch zusammen mit der Journalistin Jeanne Turczynski geschrieben hat, in seinem Büro am St. Marien-Hospital in Hamm. Er ist dort Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Beine lehrt zudem als Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke.
ZEIT: Herr Beine, Sie haben inzwischen Ihr drittes Buch über Tötungen im Krankenhaus geschrieben. Warum beschäftigt dieses Thema Sie so sehr?
Beine: Ich habe in den neunziger Jahren in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, in der ein Krankenpfleger überführt wurde, der Patienten getötet hat. Diesen Pfleger kannte ich, und einen Patienten, den er umgebracht hat, kannte ich auch. Das hat mich damals tief bewegt.
ZEIT: In Ihrem neuen Buch schreiben Sie, in Krankenhäusern und Heimen könnte es zu mehr als 21 000 Tötungen gekommen sein – in einem Jahr. Wie kommen Sie auf eine so große Zahl?
Beine: Mehr als 5000 Ärzte und Pfleger in ganz Deutschland haben einen Fragebogen ausgefüllt, auf dem unter anderem diese beiden Fragen standen: »Haben Sie selbst schon einmal aktiv das Leiden von Patienten beendet?« Und: »Haben Sie in den vergangenen zwölf Monaten schon einmal von einem oder mehreren Fällen gehört, bei denen an Ihrem Arbeitsplatz das Leiden von Patienten aktiv beendet wurde?« Aus den Antworten haben wir diese Zahl errechnet.
ZEIT: Wie haben Sie die Teilnehmer der Befragung ausgewählt?
Beine: Wir haben alle Krankenhäuser und Pflegeheime in Deutschland angeschrieben, per Mail und per Post.
ZEIT: Das heißt, die Leute haben selbst entschieden, ob sie an der Umfrage teilnehmen. Und sie wussten auch, worum es im Fragebogen geht?
Beine: Ja.
ZEIT: Dann liegt es nahe, zu unterstellen: Klinikangestellte, die solche Fälle mitbekommen haben und sich darüber Sorgen machen, nehmen eher an der Befragung teil. Könnte das nicht zu einer Verzerrung führen?
Beine: Ja, diese Gefahr besteht. Aber das ist bei Befragungen immer so. Über diejenigen, die nicht geantwortet haben, lässt sich trefflich spekulieren.
ZEIT: Sie kommen, ausgehend von Ihrer Befragung, auf 14 461 Tötungen in Krankenhäusern und 6857 Tötungen in Heimen. Wie genau sind Sie zu diesen Zahlen gelangt?
Beine: Wir haben die Ergebnisse aus den Fragebögen auf die Gesamtzahl der in Krankenhäusern und in Pflegeheimen tätigen Krankenpfleger, Altenpfleger und Ärzte bezogen.
ZEIT: Das heißt, Sie haben die Stichprobe behandelt, als sei sie repräsentativ.
Beine: Nein, wenn ich das getan hätte, dann hätte ich das als Hochrechnung bezeichnet, nicht als empirische Schätzung. Darauf wird im Buch ausdrücklich hingewiesen. Deshalb stehen die Aussagen über die Zahl der Tötungen auch überall im Konjunktiv. Und es heißt ausdrücklich, dass sich hinter »aktiv beenden« sehr unterschiedliche Tötungsdelikte verbergen können.
Tatsächlich nutzt Beine im Buch konsequent den Konjunktiv und sagt, dass die Befragung nicht repräsentativ sei. Doch obwohl er im Interview nicht den Begriff »Hochrechnung« verwenden will, finden wir bei erneuter Lektüre seines Buchs folgende Formulierung: »Rechnet man diese Zahlen auf die Gesamtheit aller in Deutschland tätigen Ärzte und Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen hoch, würde sich folgendes Bild ergeben […]« (»Tatort Krankenhaus«, Seite 12)ZEIT: Aber sind in dieser Zahl, 21 000, nicht auch viele Fälle von passiver Sterbehilfe enthalten? Wenn ein Arzt etwa einer Patientin, die bald sterben wird, Morphium spritzt, um ihre Schmerzen zu lindern, nimmt er damit oftmals in Kauf, dass er damit ihr Leben verkürzt. Dieser Mediziner hätte auf Ihre Fragen vielleicht genauso mit Ja geantwortet wie mancher Arzt, der auf der Intensivstation arbeitet und eine lebensnotwendige Maschine bei einem todgeweihten Patienten nicht weiterlaufen lässt ...
Beine: Das kann ich nicht ausschließen. Unsere Fragen lassen sicher einen Interpretationsspielraum. Aber: »Aktives Beenden« ist in meinen Augen etwas anderes als Beihilfe zum Suizid oder die Behandlung von Schmerzen, wenn dabei unbeabsichtigte Nebenwirkungen auftreten, die den Sterbevorgang verkürzen.
ZEIT: Was glauben Sie: In wie vielen der 21 000 Fälle ging es um passive Sterbehilfe?
Beine: Das kann ich Ihnen nicht sagen.
ZEIT: Die deutliche Mehrheit?
Beine: Ich würde mich da ungern festlegen. Wie häufig die spezifische Kombination aus Persönlichkeitsmerkmalen und Arbeitsbedingungen wirklich zu einer Tötungsserie führt, können wir auch jetzt nicht sagen. Da muss weiter geforscht werden. Aber immerhin sind in den vergangenen Jahren allein im deutschen Sprachraum zehn Tötungsserien bekannt geworden. Außerdem bin ich in den vergangenen 25 Jahren häufiger um Beratung bei suspektem Verhalten gebeten worden. Erst Anfang März 2017 hat ein Altenpfleger aus Rheinland–Pfalz gestanden, dass er eine Heimbewohnerin getötet hat. Aus all diesen Gründen fällt es schwer, die Behauptung von den Einzelfällen aufrechtzuerhalten.
ZEIT: Warum haben Sie im Fragebogen die Formulierung »Haben Sie selbst schon einmal aktiv das Leiden von Patienten beendet?« verwendet und nicht geschrieben »das Leben beendet«?
Beine: Weil es ein besonders schwieriges Thema ist. Ich konnte ja nicht fragen: »Haben Sie schon einmal einen Patienten getötet?« Die Fragestellung führt dazu, dass man etwas mehr erfährt, obwohl die Formulierung Interpretationsspielraum bietet.
ZEIT: Aber war es nicht Ihr Anliegen, vorsätzliche Tötungen aufzudecken? Mit dem Begriff »Leiden« haben Sie wahrscheinlich, wie Sie selbst sagen, eine große Zahl von Menschen miterfasst, die keine aktive Tötung begangen, sondern passiv Sterbehilfe geleistet haben. Situationen, über die wohl viele sagen würden: Das kann man nachvollziehen. Wenn Sie nach »Leben beendet« gefragt hätten, wären Sie wahrscheinlich zu einer viel kleineren Zahl gekommen.
Beine: Ich hätte womöglich gar keinen Rücklauf bekommen. Hinter der Entscheidung für die Formulierung steht eine pragmatische Abwägung, wir haben lange darüber beraten.
ZEIT: Sie hätten im Buch auch die Zahl der Pfleger und Ärzte nennen können, die in Ihrer Stichprobe mit Ja geantwortet hat. Wieso haben Sie überhaupt hochgerechnet?
Beine: Ich habe die Zahlen nicht als Hochrechnung deklariert, sondern als empirisch basierte Schätzung. Das habe ich getan, um die These zu erschüttern, dass es sich um Einzeltaten handelt. Genau diese These wird immer wieder vorgetragen von den Verantwortlichen aus der Selbstverwaltung und aus der Politik. Das bedarf der Überprüfung, das müssen wir weiter erforschen. Darum geht es mir.
ZEIT: In der Ankündigung zu Ihrem Buch steht: »Tausende Patienten bezahlen das mit ihrem Leben.« Auf der Verlagsseite steht, dass Sie und Ihre Co-Autorin »einen Skandal von ungeheurem Ausmaß« aufdecken.
Beine: Das ist die Pressemeldung für das Buch, für das wir stehen.
Wir erleben Beine als äußerst zurückhaltenden Menschen. An einer Stelle des Interviews müssen wir ihn bitten, das Fenster in seinem Büro zu schließen, weil seine Stimme gegen den Baulärm nicht ankommt. Als wir auf die reißerischen Formulierungen zu sprechen kommen, wird er unruhig, nimmt sich sein Notizbuch. Er scheint sich mit der Wortwahl unwohl zu fühlen – und trotzdem hat er sie mitgetragen.ZEIT: War das Ihr Antrieb, dass Sie die Welt auf dieses Problem aufmerksam machen wollten? Dass in den Krankenhäusern etwas passiert, von dem viele vielleicht nichts ahnen?
Beine: (überlegt) Ja. Das stimmt schon: Ich will darauf hinweisen, dass es in unserem Gesundheitssystem an dieser Stelle ein Problem gibt, auf das wir sehr genau achten müssen.
ZEIT: Wenn man als Laie diese Zahl sieht, 21 000 Getötete, da bekommt man doch Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Was würden Sie einem Leser raten?
Beine: Die Augen offen zu halten. Auf die Atmosphäre zu achten. Wie sprechen die Ärzte und Pfleger mit ihm? Sprechen sie überhaupt mit ihm? Er sollte sich darauf einstellen, dass Angestellte in Krankenhäusern extrem gestresst und genervt sein können. Und sich umhören, welche Klinik andere ihm empfehlen.
ZEIT: Was antworten Sie, wenn ein Leser fragt, ob er Angst haben muss, in eine Klinik zu gehen?
Beine: (langes Schweigen) Ich würde sagen, du musst keine Angst haben, aber pass auf.
ZEIT: Über diese Frage mussten Sie jetzt lange nachdenken.
Beine: (sehr energisch) Ja! Weil ich abwägen musste, wie viel ich gesehen und gehört habe in all den Jahren – und welche Konstellationen ich kenne. Die Angst sollte nicht so groß sein, dass man sich als Patient medizinisch notwendigen Eingriffen in Krankenhäusern nicht unterzieht. Aber die Patientensicherheit ließe sich eben noch deutlich verbessern. Das fängt bei verbalen Grobheiten und Behandlungsfehlern an und kann im Extremfall mit medikamentös herbeigeführten Todesfällen enden. Deshalb plädiere ich im Buch für Patientenschutzbeauftragte in den Kliniken.
Bei dieser Antwort erhebt Beine zum ersten Mal die Stimme. Vielleicht realisiert er erst jetzt, dass die Zahl, die er da in die Welt gesetzt hat, vielen Patienten einfach Angst machen könnte.
ZEIT: Missstände gibt es nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Verbale und körperliche Gewalt kommt auch in der häuslichen Pflege vor, zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Deutschland werden ja zu Hause versorgt. Wo sollen sich Patienten und Pflegebedürftige überhaupt noch sicher fühlen?
Beine: Es gibt meines Wissens keine empirische Studie über häusliche Gewalt gegen Pflegebedürftige, aber auch da hören wir immer wieder von spektakulären Einzelfällen, ohne das Dunkelfeld zu kennen. Letztlich wissen wir nicht, wo der sicherere Ort ist.
ZEIT: Sie haben die Ergebnisse Ihrer Befragung nicht in einem Forschungsjournal publiziert, wo sie vor der Veröffentlichung von Fachkollegen geprüft worden wäre, sondern in einem populären Sachbuch für das breite Publikum. Wieso? Weil Sie auf diesem Weg am meisten Menschen erreichen?
Beine: Ja, ich erreiche dadurch mehr Leute – und das wollte ich auch. Dieses Anliegen habe ich, und ich sehe mein Buch als Debattenbuch. Ein Teil des Datensatzes ist übrigens wissenschaftlich aufbereitet worden und bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift zum Peer-Review eingereicht.
Als Psychiater hat Beine einige der spektakulärsten Tötungsserien in Kliniken untersucht. Im Gespräch kommt er mehrmals darauf zurück: Bei fast allen Tätern habe es klare Anzeichen gegeben, die vom Umfeld übersehen oder nicht beachtet wurden. Wir werden das Gefühl nicht los, dass Beine angesichts dessen bis heute fassungslos ist. Eine Mitschuld gibt er dem Gesundheitssystem, das die Tötungen möglich gemacht habe. Diese These ist zwar plausibel, er kann sie mit seiner Umfrage aber nicht beweisen. Und auch in seinem neuen Buch werden immer wieder Einzelfälle als Beleg dafür angeführt, dass etwas systematisch schiefläuft.ZEIT: Was muss sich Ihrer Meinung nach im Gesundheitssystem ändern, damit Patienten mit einem besseren Gefühl in die Klinik gehen können?
Beine: Die Politik muss gesetzlich sicherstellen, dass genug Ärzte und Pfleger für die Behandlung und Betreuung der Patienten vorhanden sind. Außerdem müssen wir die Zahl der Kliniken reduzieren. Im Moment nehmen viele Häuser Eingriffe vor, für die sie gar nicht geeignet sind. Das Problem, dass wir zu viele Krankenhäuser haben, soll offensichtlich über den Wettbewerb gelöst werden: Irgendwann ist ein Haus pleite. Aber bis es so weit ist, rüsten die Kliniken technisch immer weiter hoch, in der Hoffnung, dass es den Konkurrenten früher trifft. Und wir brauchen eine andere Fehlerkultur.
ZEIT: Können Sie das genauer ausführen?
Beine: Es darf kein Wettbewerbsnachteil für Kliniken sein, wenn dort offen über Fehler gesprochen wird, im Sinne von »Das ist nicht gut für unser Haus«. Wir müssen die zukünftigen Pfleger und Ärzte schon in der Ausbildung ermuntern, Fehler zuzugeben. Sie müssen verstehen, dass das keine Schwäche ist, sondern ein Akt von Souveränität. Ein Chef darf nicht auf denjenigen einprügeln, der etwas falsch gemacht hat. Egal, wie schlimm die Folgen des Fehlers sein mögen: Es muss klar sein, dass es besser ist, offen darüber zu sprechen, als ihn zu vertuschen.
ZEIT: Sie sind selbst Chefarzt. Was können Vorgesetzte dazu beitragen?
Beine: Für mich ist ein zentraler Punkt: Vorgesetzte müssen sich wirklich dafür interessieren, wie es ihren Mitarbeitern und den Menschen geht, die von ihnen versorgt werden. Damit nicht diese Laisser-faire-Stimmung entsteht, wo die Leute das Gefühl haben: Es ist egal, was wir hier machen, das kriegt ohnehin keiner mit.
ZEIT: Sie plädieren in Ihrem Buch dafür, dass angehende Mediziner und Pfleger besser ausgewählt werden sollen. Gleichzeitig kritisieren Sie, dass es nicht genug Personal gebe. Das ist ein Widerspruch.
Beine: Ich hoffe, dass das Krankenhaus als Arbeitsplatz für Ärzte und vor allem Pfleger wieder attraktiver wird, wenn wir Kurskorrekturen am Gesundheitssystem vornehmen. Wenn Medizin und Pflege weniger durch wirtschaftliche Zwänge dominiert werden, schafft das Gestaltungsspielraum, und das ist es, was an diesen Berufen eigentlich Freude macht.
ZEIT: Am Ende des Buches steht der ehrliche Satz: Wir werden uns nicht jede Technik und alle Medizin zu jedem Preis für alle leisten können. Woher soll das Geld kommen für die Maßnahmen, die Sie fordern?
Beine: Wir haben in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zum Beispiel zu viele Implantationen von künstlichen Hüftgelenken, zu viele Rückenoperationen und Kniegelenkspiegelungen. Weil diese Eingriffe den Krankenhäusern Geld bringen. Wenn man dafür sorgen würde, dass sie wirklich nur durchgeführt werden, wenn sie medizinisch sinnvoll sind, hätten wir sicher kein Geldproblem. Ich bin davon überzeugt, dass unserem Gesundheitswesen alles Mögliche fehlt, aber kein Geld.
Nach dem Gespräch mit Karl Beine ist aus unserer Sicht klar: Die Zahl, die uns zu ihm geführt hat, lässt sich so nicht halten. Andererseits treibt den Buchautor ein Anliegen um, das wir nachvollziehen können. Er will auf Missstände im Gesundheitssystem aufmerksam machen. Und die gibt es ohne Zweifel. Der Weg, den er dafür gewählt hat, ist unserer Meinung nach der falsche.
 wir dürfen bei solchen horror-zahlen nicht äpfel mit birnen verwechseln. natürlich ist angesichts der apparate-medizin im computer-zeitalter dem arzt - aber auch den nahen anverwandten - eine große verantwortung übertragen:
wir dürfen bei solchen horror-zahlen nicht äpfel mit birnen verwechseln. natürlich ist angesichts der apparate-medizin im computer-zeitalter dem arzt - aber auch den nahen anverwandten - eine große verantwortung übertragen: da menschliches leben "künstlich" erhaltbar ist, muss man sich entscheiden, wann man ethisch und moralisch ein solches leben beenden darf oder auch vielleicht "sinnvoll" beenden muss ...
wir haben in dieser beziehung dem lieben gott seine alleinige entscheidung aus der hand genommen - aber vielleicht hat er sie auch an uns delegiert ...
eine human verträgliche und allseits kommunizierte passive sterbehilfe - wie sie in seriösen palliativ-stationen bei bedarf geübt wird - ist meines erachtens keine "patienten-tötung" im eigentlichen sinne - zumeist gibt es ja vielleicht entsprechende verfügungen und äußerungen, die das so nahelegen.
allerdings widerspricht die zunehmende krankenhaus-industrialisierung und die unsäglichen vorausbestimmungen einer buchhalterischen plan-/sollzahl der bettendurchlaufzahlen sowie die abrechnung in altenheimen nach puren "betten-tagen" einer humanen und begleiteten ethisch verantwortbaren sterbepraxis, wie sie sicherlich von allen - ob atheist oder christ oder muslim oder buddhist usw. erwartet wird in seinem jeweiligen letzten stündchen ...
hier ist schleunigst nachzubessern: es heißt ja "humanmedizin" und nicht "fallzahlmedizin" - noch ...